





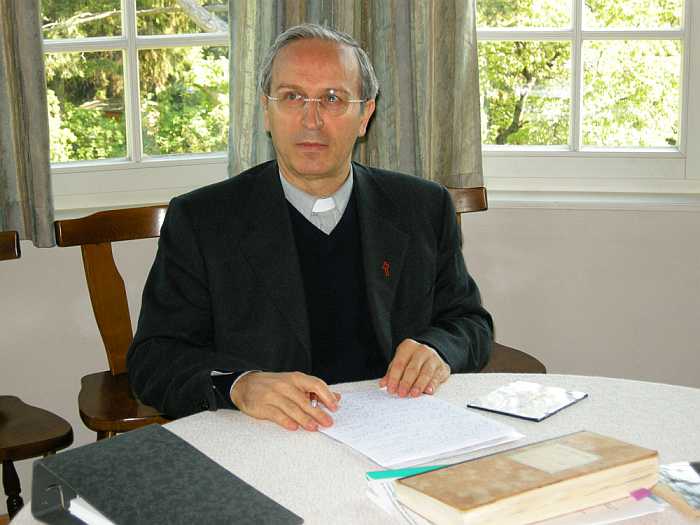
Der Testamentsbrief des hl. Kamillus
Eine erneute historisch-spirituelle Betrachtung
P. Renato Salvatore
Vom hl. Kamillus selbst wurde dieser Brief niemals als sein Testament bezeichnet, seine Ordensleute hingegen haben ihn immer als solches aufgefasst. Aus diesem Grunde bewahrte man ihn sorgfältig auf und gab ihn an die nachkommenden Mitglieder weiter. So respektierte man den Wunsch, den der hl. Kamillus ausgedrückt hatte: „Es ist mein Anliegen und mein Wille, dass man diesen Brief zur ewigen Erinnerung in das Archiv gibt, in dem man die Schriftstücke des Hauses aufbewahrt, und darauf achtet, dass er nicht verloren geht.”
Eigenartiger Weise erwähnt P. Cicatelli in keiner Ausgabe seiner Lebensbeschreibung des hl. Kamillus diesen Brief. Aber P. Novati war es, der dessen ganze Bedeutung erkannt hatte, so dass er ihn zum Abschluss des Generalkapitels am 14. Mai 1640 vorlas. Er war der Erste, der ihn als Testament bezeichnete, und zwar in einem Brief vom 19. Mai 1640 an P. Francesco M. Giovardi, der im Spital von Genua tätig war.[1]
Am 28. Oktober 1641 ließ der Adelige Lorenzo Olivero aus Genua den Testamentsbrief im Druck veröffentlichen - versehen mit einer Widmung für P. Novati: „Brief des verehrungswürdigen Paters Kamillus von Lellis, Gründer des Ordens der Diener der Kranken, ganz auf die Erhaltung und das Wachstum der Gründung bedacht.” P. Novati hat diese erste gedruckte Ausgabe des Testamentsbriefs im Archiv des Generalats aufbewahrt. Im darauf folgenden Jahr finden wir ebenfalls eine gedruckte Ausgabe dieses Briefes in den Annalen des P. Lenzo (1642).
P. Gangi entdeckte im Jahre 1717 die verloren gegangenen Original-Akten, die von Kamillus unterschrieben waren. In einer angefügten Notiz wird berichtet, dass bei diesen Dokumenten auch „der authentische letzte Brief war, den Kamillus wenige Tage vor seinem Tod schrieb und in dem er empfahl, dass man diesen zur ewigen Erinnerung in unserem Archiv aufbewahren und sorgfältig beachten soll” (Intr., S. XXI).
P. General Domenico Costantini „ließ kurz vor der Heiligsprechung des Kamillus (1746)[2] jeder Gemeinschaft des Ordens eine Kopie des Testamentsbriefs zukommen, damit man durch die Meditation des Textes den authentischen Geist des Ordens und die wahrhafte kamillianische Spiritualität erfassen konnte”[3].
Während seiner kanonischen Visitation der Lombardo-venetianischen Provinz im Mai 1845 schenkte P. General Luigi Togni jedem Ordensmann eine Kopie des Testamentsbriefs. Drei Jahre später, im Jahre 1848, veröffentlichte ebenfalls P. General Togni im Anhang der Neuausgabe der Regeln und Konstitutionen[4] den Text des „Testamentsbriefs”[5] als „jener berühmte und nicht genug zu empfehlende Brief unseres heiligen Vaters Kamillus, der von ihm geschrieben wurde, als er im Begriff war, von der Erde in den Himmel zu wechseln, und der sich an alle und einen jeden einzelnen Professen richtet zu allen Zeiten des von ihm gegründeten Ordens”.
P. Camillo Cesare Bresciani orientierte sich sehr stark an diesem Brief. In den zwölf Ausgaben des „Domesticum” des Jahres 1903 wurden die Regeln und Konstitutionen des Jahres 1848 veröffentlicht, mit einem Kommentar zu diesem Brief. In der Folgezeit, und zwar im Jahre 1906, wurde der Text auf einem Blatt publiziert („Testamentsbrief des heiligen Vaters Kamillus”), das in jedem Haus ausgehängt werden sollte.
Im Jahre 1914 wurde der Brief (jener vom 10. Juli 1614) im Buch des Priesters Paolo de Töth, „I Padri Ministri degli Infermi o del Bel Morire in Firenze” (Ed. Fiorentina), abgedruckt. Im Jahre 1920 veröffentlichte ein gewisser G. M. Monti in einer Zeitschrift („Rivista trimestrale di studi filosofici e religiosi”) eine authentische Kopie des Testamentsbriefs des hl. Kamillus, die sich in seinem Besitze befand.[6]
In den Jahren 1928 bis 1929 verbreitete P. General Pio Holzer eine Reproduktion des handgeschriebenen Textes in einem etwas kleinerem Format. Das Original (85 x 70 cm) wird in der Maddalena eingerahmt aufbewahrt.[7]
1929 wurde der Testamentsbrief in der neuen „Vita di S. Camillo de Lellis” (S. 621-624) publiziert und ist auch in der von P. Müller herausgegebenen Sammlung „Lettere del N. S. P. Camillo”(XXXI, S. 48-51) zu finden, ferner auch im Buch „Storia dell’Ordine” (S. 107 ff.), versehen mit einem historisch-kritischen Kommentar.
In der Folgezeit erlebte der Brief viele Drucklegungen und Übersetzungen in den Sprachen der Länder, in denen sich die Kamillianer verbreitet hatten.
2. Die authentischen Exemplare des Testamentsbriefs
Wir besitzen fünf vom hl. Kamillus unterschriebene Testamentsbriefe. Sie haben folgendes Datum: 14., 20., 24., 29. Juni und 10. Juli (1614). Der erste Brief entstand, als „Kamillus, am Beginn des Monats Juni anfing, sich gesundheitlich zu verschlechtern. Die Abscheu vor den Speisen, das Sodbrennen, die Schlaflosigkeit verließen ihn nicht. Sein Geist wurde durch Ängste und Verzagtheit geplagt. Er sah nichts Gutes in seinem Leben und die guten Werke kamen ihm mangelhaft vor, sie erweckten ihm sogar Widerwillen” [...]. Am 2. Juli empfing er von Kardinal Ginnasi die Wegzehrung und um 11 Uhr gab ihm P. General in Anwesenheit der ganzen Kommunität die Krankensalbung.[8]
Der erste Brief - vom 14. Juni - wurde an die größte Gemeinschaft geschickt, nämlich an die von Neapel. In ihr fehlen zwei Empfehlungen, die dann später hinzugekommen sind: bezüglich der Gemeinschaften in kleinen Orten und die Ermahnung, sich nicht auf die alleinige geistliche Betreuung zu beschränken.
Der zweite Text stammt vom 20. Juni und befand sich im Besitz von Monti. Es handelt sich um das Exemplar, das für Chieti bestimmt war (Crocelle, die Kirche des Spitals). Dieser Brief hat gegenüber dem ersten Schreiben - abgesehen von dem hinzugefügten Text, „weil ich ohne Zweifel in den nächsten Tagen zum anderen Leben hinübergehen werde”, keine wesentlichen Änderungen.[9] Im Archiv des Generalats (Handschriften-Kodex Nr. 2519) wird eine mit 20. Juni 1614 datierte Kopie aufbewahrt. Dieser Text wurde nicht von dem vorhergehenden Brief abgeschrieben, sondern von einem anderen Exemplar, von dem wir kein Original haben. Es handelt sich um das Exemplar, dessen Text P. General Togni den Ordensmitgliedern der Lombardo-venetianischen Provinz geschenkt hat. Ein drittes Exemplar, das mit 20. Juni datiert ist und in Genua am 28. Oktober in Druck gegeben wurde, stammt von einem zweiten Original mit einer eigenhändigen Unterschrift, das vom Gründer an diese Kommunität geschickt worden war. Ein viertes Exemplar (1742) wird im staatlichen Archiv von Mailand aufbewahrt.[10]
Der Text vom 24. Juni (im Archiv des Generalats Nr. 2815) wurde „an die hochwürdigen und lieben Patres und Brüder von den Dienern der Kranken im Hause von Bucchianico” gesandt. Hier erscheinen zwei neue Empfehlungen, die auch in den folgenden Briefen zu finden sind: a) „Ich erkläre auch (Zeilen 75-77), dass es meinem Willen entspricht, dass man nicht nur in großen und mittleren Städten Gründungen eröffnet, sondern auch an kleinen Orten, an denen zwölf Ordensleute von den Almosen leben können, damit sie jenen armen Seelen helfen, die an diesen Orten leben.” b) „Außerdem will ich, dass man niemals allein die geistliche Betreuung ohne die körperliche Pflege übernimmt, wie es in der zweiten Bulle geschrieben steht.” - Es existieren keine anderen Texte (weder Originale noch Kopien) mit dem Datum 24. Juni.
Im Archiv des Generalats (Nr. 2816) wird ein authentischer Brief vom 29. Juni 1614 aufbewahrt, der mit einer handgeschriebenen Unterschrift versehen ist. Dieser wurde an die Gemeinschaft in Mailand gesandt. Eine Kopie dieses Schreibens bewahrt man in der Ambrosianischen Bibliothek auf (G. 56. R. 2809).[11]
Der letzte originale Text hat das Datum vom 10. Juli 1614 und ist mit einer handgeschriebenen Unterschrift des hl. Kamillus versehen. Diese befand sich fast im Zentrum des Blattes und enthält keine Adresse, weil das Schreiben für das General-Archiv des Ordens bestimmt war. Der General P. Francesco Monforte brachte es 1684 nach Palermo.[12] Pater General Nicolò du Mortier (1699-1705) bemerkte das Fehlen des Briefes, veranlasste seine Rückgabe und ließ sofort eine getreue Kopie anfertigen. Derzeit ist der Brief im Generalatshaus ausgestellt, und zwar im Cubiculum. Auf den Brief vom 10. Juli wird für gewöhnlich Bezug genommen.[13]
3. Die Botschaft des Testamentsbriefs
In diesem Vortrages sind wir aufgerufen, uns sozusagen geistig am Krankenbett unseres Gründers zu versammeln und zu hören, was er uns sagen möchte, in dem Bewusstsein, dass ihm auf dieser Erde nur mehr wenige Lebenstage zur Verfügung stehen. Wir erinnern uns, dass er folgende schwere Krankheiten zu ertragen hatte: die unheilbare Fuß-Wunde seit 40 Jahren; den Leistenbruch seit 38 Jahren; die Hühneraugen an den Füssen seit 25 Jahren; die Nierensteine seit zehn Jahren und seit zweieinhalb Jahren eine große Appetitlosigkeit, die ihn dann bis zum Tode begleitete. Diese Krankheiten sind Teil eines verzehrenden Lebens der Nächstenliebe, wie ein Zeuge im Heiligsprechungsprozess erklärte: „Als er starb, war er nur sechzigjährig, aber er hatte hundertfünfzig Jahre an Mühen und Leiden hinter sich.” Von anderen Zeugen wissen wir, dass er nur äußerst wenig aß und schlief, dass er bis zur Erschöpfung arbeitete und sich nichtsdestoweniger harten Bußübungen unterzog. Er erschien wie „ein Mensch aus Eisen oder Marmor und nicht aus Fleisch und Blut wie alle anderen.” Im Spital erlaubte er sich nach einem Arbeitstag, nicht mehr als zwei Stunden auszuruhen. Eines Nachts bat er einen seiner Gefährten, ihn um Mitternacht aufzuwecken, aber dieser ließ ihn weiterhin schlafen, weil er ihn äußerst müde vorgefunden hatte. Kamillus aber war darüber keineswegs erfreut und am Morgen beschwerte er sich beim Mitbruder: „Gott soll es dir verzeihen, Bruder, und wann soll ich etwas Gutes tun, nachdem ich eine Nacht durch dich verloren habe, die ich im Dienste der Kranken hätte verbringen können?”
Da er sich in diesem Zustand befindet, fühlt er die Pflicht, sich an seine Söhne, die gegenwärtigen und die künftigen, zu wenden, damit sie sich selbst und dem Orden treu bleiben in Bezug auf das, was Gott verlangt. Er hat keine zeitlichen Güter zu hinterlassen, sondern vielmehr nicht geringe Geldschulden. Um diese ist er hingegen weniger besorgt - er hinterließ gut 34.000 Scudi Schulden!
Mitglieder eines von Gott gewollten Ordens
Kamillus ist mehr als überzeugt, dass der Orden der Diener der Kranken von Gott zu unserem Segen und zum Wohl der Leidenden für den umfassenden Beistand der Kranken gewollt ist und auf diese Weise dem Evangelium und der Lehre Christi entspricht.[14] Der Herr selbst gab das Beispiel mit einem Leben, das der Heilung von Krankheiten jeglicher Art gewidmet war. Und man durfte sich nicht so sehr darüber wundern, dass er, um diesen Orden zu gründen, sich „eines großen Sünders, eines Ungebildeten und mit vielen Fehlern und Mängeln Behafteten, der tausend Höllen verdient”, bedient hatte. Gott ist frei, so zu handeln, wie es ihm am besten gefällt; ja wenn er so handelt, offenbart er umso mehr seine Herrlichkeit: „Aus meiner Nichtigkeit hat er Wunderbares gemacht!”
Letzthin wollte er betonen, was er schon oft gesagt hatte: „Die Existenz dieses Ordens ist an und für sich schon ein offenbares Wunder, aber dass Gott sich solch eines unwürdigen Menschen bedient hat, macht dieses Wunder noch größer.” Eine andere schöne Auffassung, die direkt mit dieser Überzeugung verbunden war, wurde sehr oft von unserem Gründer während seines Lebens bekundet: Diener der Kranken zu sein ist ein großes Geschenk, eine Garantie für das ewige Leben. Hier könnte man sich zumindest an einige kamillianische Seligpreisungen erinnern:
Da dieser Orden ausdrücklich von Gott gewollt war und ungeheure Möglichkeiten für das Gute besitzt, wird er in besonderer Weise im Teufel einen Widersacher finden. Die Worte, die unser Gründer gebraucht, offenbaren in ihm das Vorhandensein einer großen Angst für die Zukunft der kleinen Pflanze, eine Sorge, die Kamillus durch viele Jahre mit sich trug. In Wahrheit erfuhr bereits sein anfängliches Projekt den Widerstand der Verantwortlichen des Spitals San Giacomo und seines Seelenführers und Beichtvaters Philipp Neri. Es muss nicht besonders leicht für Kamillus gewesen sein, der ein Laie mit geringer Bildung war, dem beharrlichen und starken Abraten dieses Priesters, der in Rom äußerst große Wertschätzung und Achtung erfuhr, Widerstand zu leisten. Aber die Hindernisse hörten sogar mit der Anerkennung des Ordens (11. Oktober 1591) nicht auf. 1595 fing eine interne Auseinandersetzung an, die sich durch Jahre hinzog und die nicht einmal mit der direkten Intervention des Papstes durch die zweite Bulle (Superna Dispositione, 29. Dezember 1600) gänzlich beendet wurde. Auf dieses päpstliche Schreiben bezieht sich Kamillus auch in seinem Testamentsbrief.
Da man in so kurzer Zeit bereits sehr viele Schwierigkeiten überwinden musste, war es verständlich, dass die Furcht vor weiteren in den Folgezeiten entstand. Der Teufel wird alles versuchen, die von Gott gewollte Pflanze zu zerstören. Er kann sich sogar einiger Ordensleute bedienen, die sich verwirren lassen und daher eine Gefahr sind, dass der Ordenszweck verfälscht oder verändert wird. Er ermahnt deshalb die Gegenwärtigen und die Zukünftigen, in Aufrichtigkeit gemäß den vom Heiligen Stuhl gegebenen Vorschriften zu leben. Allgegenwärtig ist das Risiko, dass Ordensmitglieder, die die eigenen Wurzeln wenig kennen oder schätzen, als Pseudo-Reformatoren, als Aufrührer und auf der Suche nach Neuerungen um ihrer selbst willen agieren.[15]
Wie soll man die kamillianische Geschichte im Lichte dieser Besorgtheiten bzw. Empfehlungen des Gründers beurteilen? In welchen Dingen sind wir besonders treu oder untreu gewesen? Ist es uns gelungen in den verschiedenen Epochen das Charisma in Treue und Kreativität zu verwirklichen? Viele andere Fragen könnten wir uns im Blick auf eine bereits mehrere Jahrhunderte dauernden Geschichte stellen, aber das würde den Rahmen dieser Überlegungen sprengen.
Die vollkommene Befolgung der Armut
Da ich bei der Thematik des Briefes unseres Heiligen P. Kamillus bleiben will, höre ich zunächst seine leidenschaftliche Einladung: „... Wir müssen mit jeder erdenklichen Sorgfalt die Reinheit unserer Armut bewahren ..., denn unser Orden wird solange Bestand haben, wie unsere Armut auf das Genaueste befolgt wird. Deswegen ermahne ich alle, treueste Verteidiger dieses heiligen Gelübdes der Armut zu sein, und nicht zuzustimmen, dass es in irgendeiner Weise verändert wird oder dass man abweicht von seiner Reinheit.”
Diese Eindringlichkeit verwundert. Man hätte eher von seinem Herzen einen kraftvollen Aufruf zur Nächstenliebe, von der es gänzlich durchdrungen war, erwarten können; oder auch eine Empfehlung zum Gehorsam, da er ein ehemaliger Soldat war und ein Ordensgründer; oder auch einen Aufruf zur Keuschheit, von einem Menschen, der es sogar vermieden hatte, in das Gesicht einer Frau zu blicken. Er ist hingegen besorgt um die Einhaltung des Gelübdes der Armut! Und er hatte wirklich nicht Unrecht. In der Bulle „Illius qui pro gregis” (1591) wurde die Armut der Bettelorden bestimmt. Die Schwierigkeit, für den Unterhalt der Ausbildungshäuser und der kranken und alten Ordensmitglieder zu sorgen, führte dahin, dass diese Strenge abgemildert wurde (durch „Superna dispositione”, 1600). Für diese Häuser des Ordens wurde die Fähigkeit zum Besitz gestattet. Die letzte Etappe auf dem Weg der Abschwächung des Willens des Gründers wurde durch die Bulle von Papst Clemens XIII. „Inter plurima et egregia” (24. August 1764) erreicht. Von diesem Zeitpunkt an hatten alle Häuser des Ordens das Besitzrecht.
Wie soll man diese starke Mahnung beurteilen? Unser heiliger Gründer spricht davon am Ende eines Lebens, das er in tiefster Armut gelebt hatte. Ich erinnere an manche Begebenheiten und Zeugenaussagen: Am Vorabend der Profess vom 8. Dezember 1591 kniete er sich vor allen nieder mit Tränen in den Augen und sagte, dass er sich von allem, was er hatte, entäußere. Und er bat alle Mitbrüder darum, dass man ihm als Leihgabe den Talar, das Hemd und alle anderen Kleidungsstücke, die er anhatte, überlasse. Und er stand nicht auf, bevor nicht alle Ordensleute antworteten, dass man ihm als Almosen das borge, was er anhatte - ferner auch das Bett und alles, was er im Zimmer aufbewahrte. Alle Mitbrüder waren darauf durch diese edle Geste des Gründers innerlich bewegt. Ein jeder ging in seine Kammer, nahm das Wenige, das darinnen war, und legte es zu Füssen des hl. Kamillus. Und er gestattete nur den Gebrauch dieser Dinge und gab einen großen Segen für einen jeden von ihnen.
Ein Priester der Kamillianer gab als Zeuge an: „Ich habe ihn immer mit einem alten und abgetragenen Talar gesehen. Als er General war, trug er alte Kleidung und einmal brachte ich ihm Nadel und Zwirn und er flickte die Strümpfe, obwohl er Generaloberer war.” „Er war glücklich, wenn er mit geflickten Kleidern daherging und wenn er ein gewisses abgetragenes Birett trug, das ihm bis zu den Augen reichte und auf den Seiten derart abgegriffen und beschädigt war, dass man den Karton sah, der als Einlage diente.”
Ein Zeuge erzählte, dass er Kamillus gesehen hatte, als er Generaloberer war „wie er so arm und schlecht gekleidet einherging, dass man ihn, wenn er nicht das rote Kreuz getragen hätte, für einen verlassenen und vagierenden Priester gehalten hätte.” „Er war glücklich, wenn ihm oder seinen Ordensleuten etwas fehlte.”
Für Kamillus waren ein Leben in Armut und eine arme Kommunität (als Arme leben) Voraussetzungen, um die Nächstenliebe gegenüber den Armen (den Armen dienen) auszuüben bzw. die ganze eigene Person den Armen zur Verfügung zu stellen (bis zum Tode).
Der Verzicht auf weltliche Güter hatte einen inneren Zusammenhang mit seinem vorausgegangenen Leben. Als junger Mann suchte er das Geld, um sich im Spiel zu vergnügen. Im Augenblick seiner Bekehrung hatte er gerufen, „Keine Welt mehr, keine Welt mehr.” Der Verzicht auf ein weltliches Leben war radikal. Während des Noviziats bei den Kapuzinern lernte er die franziskanische Armut lieben. Viele Menschen hingegen - auch schon zu damaliger Zeit - benützten die Kranken, um Geld zu verdienen. Deshalb wollte er, dass die Liebe zu den Kranken davon frei sei und keine materielle Rückvergütung zur Folge hatte!
Die Armut ist ein sicherer Anzeiger für das geistliche Leben, nicht nur in der Kirchengeschichte, sondern auch in der individuellen Geschichte eines jeden von uns, insbesondere von uns Kamillianern. Welches sind in unserem konkreten Leben die Elemente, die zeigen, ob wir mehr oder weniger im Geist dieser ersten Seligkeit leben? Worin besteht das Leben als „Arme”? Der Arme im Geiste akzeptiert, dass Gott ihn durchdringt und seine Existenz durcheinander bringt und er bereit wird, sein Leben neu zu programmieren, um den Vorschlägen Gottes zu folgen. Wir werden arm, wenn wir uns vom alten Menschen befreien, von einer götzendienerischen Mentalität, vom Geist der Allmacht, wenn wir unsere Energien mit denen der anderen vereinen und akzeptieren, an einem Projekt zu arbeiten, auch wenn dieses nicht von uns geplant wurde; wenn wir uns unwiderstehlich angezogen fühlen von übernatürlichen Wirklichkeiten. Ferner, wenn wir nach Werten streben und nicht nach Besitz. Wenn wir im Stande sind, zu besitzen und zu schenken, ohne Abhängigkeiten zu schaffen.
In der Aufmerksamkeit für die Armen wird die Zukunft von uns Kamillianern entwickelt. Aber man kann nicht auf ihrer Seite stehen, wenn man nicht ein Herz hat, das durch Gott befreit wurde. Es ist notwendig, frei zu sein, um sich auf die Seite derjenigen stellen zu können, die keine Macht haben und keine Stimme, damit man auf sie hört. Es ist notwendig, durch keinen Besitz gebunden zu sein, um von jeder Erpressung und jeder Verführung frei zu werden. Frei zu sein, um frei und in einer befreienden Weise zu lieben. Frei, um sich ständig von der Stimme Gottes, die die Befreiung durch die Ankunft seines Reiches verkündet, befragen zu lassen.
Heute mehr als je zuvor bedarf es freier Menschen, die Propheten im Namen Jesu sein können, die Kritik ausüben im Blick auf die Zustände, die nicht konform sind mit den Plänen der Liebe Gottes. Menschen, die frei sind von weltlichen Banden und die auf das Jenseits ausgerichtet sind, um Zeugnis zu geben, dass die weltlichen Zustände nicht das Absolute repräsentieren. Die heutige Gesellschaft provoziert das Leben in der Nachfolge Christi besonders durch „einen habgierigen Materialismus, der gegenüber den Bedürfnissen und Leiden der Schwächsten gleichgültig ist” (Vita consecrata, Nr. 89). Wir sind dazu gerufen, darauf eine Antwort zu geben durch die Herausforderung der evangelischen Armut, „die oft von einem aktiven Einsatz bei der Förderung von Solidarität und Nächstenliebe begleitet wird” (Vita consecrata, Nr. 89). So handelte Kamillus, als er zu Monsignore Centurione (der Präfekt des Ernährungsamtes) ging, um Getreide zu erbitten. Als ihm dieser es verweigerte „wurde Kamillus von großen Eifer ergriffen und mit furchtbar lauter Stimme [man kann sich diesen zwei Meter hohen Mann mit dem Willen, seine Armen vor dem Hunger zu bewahren, vorstellen] schrie er: Hochverehrter Monsignore, wenn auf Grund dieser Rücksichtslosigkeit meine Armen leiden oder vor Hunger sterben müssen, dann protestiere ich vor Gott und lade sie vor sein furchtbares Gericht, wo Ihr genaueste Rechenschaft ablegen müsst. Und nachdem er dies gesagt hatte, ging er weg.” Der Prälat erschrak und gab ihm das Gewünschte.
Etwas weiter vorher im Brief, nachdem er die Treue zum Ordenscharisma und die in der zweiten päpstlichen Bulle enthaltenen Vorschriften betont hatte, vertraut Kamillus auf Gott, dass er selbst es sein wird, der in Zukunft seine Söhne über die Art und Weise, wie das Charisma verwirklicht werden soll, inspiriert. Wir müssen zugeben, dass wir Kamillianer die Empfehlungen unseres Gründers nicht wortgetreu befolgen. Zum Beispiel ist eine große Anzahl von Priestern Kapläne und leistet ausschließlich einen seelsorglichen Dienst! Obwohl unser Gründer in diesem Brief empfiehlt, „dass man nie die alleinige seelsorgliche Betreuung ohne die leibliche Pflege übernehmen soll, wie die zweite Bulle es bestimmt.” Im Laufe der Geschichte haben wir gelernt, den wesentlichen zentralen Kern des Charismas von seiner geschichtlichen Verwirklichung zu unterscheiden. Wir sagen, dass das Charisma unveränderbar sei, aber seine Verwirklichung (unser Dienst) sich an die geänderten Umstände der Zeit und des Ortes anzupassen hat. Diese Überlegung erlaubt es uns heute, dass wir Eigentümer von sozialen und gesundheitlichen Einrichtungen sind und mit ihnen auch karitative und ausbildnerische Tätigkeiten finanzieren. Der hl. Kamillus hingegen sagt in seinem Testamentsbrief ganz klar: Zu denken, dass man mit Almosen allein nicht leben kann, ist eine gefährlicher Betrug des Teufels, der darauf abzielt, den Orden zu zerstören. Und da er die möglichen Einwände kennt, hält er sich sehr lange bei dieser Empfehlung auf und sagt, dass man sich nicht fürchten müsse, das tägliche Brot nicht zur Verfügung zu haben. „Durch die Gnade Gottes werden wir viel zum Weggeben haben” - so sagte er, überzeugt von seinen zahlreichen Erfahrungen der Vorsehung.[16]
Die Überzeugung von der Unerlässlichkeit der radikalen Armut für die Nachfolge steckt immer - bereits von Beginn an - in Kamillus. Wir finden sie schon in der „Formula vitae”: „Wer auf Antrieb Gottes entschlossen ist, die leiblichen und geistlichen Werke der Barmherzigkeit nach Art unseres Institutes auszuüben, der wisse: Fortan muss er allen Dingen der Welt abgestorben sein: Verwandten, Freunden, irdischem Besitz und sich selbst. Er darf nur für Jesus, den Gekreuzigten, leben, unter dem sanften Joch beständiger Armut und Keuschheit sowie beständigen Gehorsams und Dienstes an den armen Kranken, selbst den Pestkranken. Tag und Nacht ... muss er ihnen in ihren leiblichen und seelischen Nöten beistehen [...] Jeder, der in unseren Orden eintreten will, soll also bedenken, dass er sich selbst tot sein muss. Der Heilige Geist wird ihm eine solche Gnadenfülle schenken, dass er sich nicht mehr sorgt um Tod und Leben, Krankheit und Gesundheit. Der Welt gestorben, gehe er ganz in der Erfüllung des Gotteswillens auf, im vollendeten Gehorsam seinen Oberen gegenüber und im völligen Verzicht auf den Eigenwillen. Er betrachte es als großen Gewinn, für unseren Herrn Christus Jesus, den Gekreuzigten, zu sterben.”
Patres und Brüder: gleiche Würde, gleiches Charisma
Auf die Aufforderung der genauen Befolgung des Gelübdes der Armut folgt die Mahnung „zur Einheit, zum Frieden und zur Eintracht zwischen Patres und Brüdern”. Das ist ein anderes großes Kapitel, von dem man zugeben muss, dass es auch jetzt noch nicht gänzlich abgeschlossen ist. Mit dieser Empfehlung traf der hl. Kamillus einen der neuralgischsten Punkte in der kamillianischen Geschichte: „Jeder soll sich davor hüten es zu wagen - unter jedwedem Vorwand des Guten - dasjenige den Brüdern wegzunehmen, was ihnen der Apostolische Heilige Stuhl gestattet hat.”[17] Kamillus war ein Laie, Spitalsverwalter von San Giacomo, als er 1582 die Inspiration hatte, eine „Gesellschaft von frommen und ehrenwerten Männern” zu gründen. Er wäre auch Laie geblieben, wenn es nicht notwendig gewesen wäre, Priester zu werden, um diesen Plan zu verwirklichen.[18]
Für Kamillus „war es notwendig, dass Patres und Brüder einträchtig zusammenarbeiteten und den Dienst an den Kranken auf gleichgestellter Ebene verwirklichten [...] Diese einzigartige Art der Beziehung, die bei den Orden der damaligen Zeit nicht ihresgleichen hatte, war eine Konsequenz des Charismas für den Dienst an der Person des Kranken mit ihren konkreten Bedürfnissen [...]
Die Behandlung des Kranken unter dem zweifachen Aspekt, dem gesundheitlichen und dem geistlichen, ist der wichtigste Punkt in der von Kamillus begonnenen Reform. Alle Diener der Kranken arbeiten zum Wohl des Kranken, und zwar mit den wesentlichen Aufgaben, die komplementär sind und auf diese Weise die enge Zergliederung in Sektoren überwinden. Die Zeugnisse der zur Zeit des Gründers lebenden Ordensleute, die ersten offiziellen Dokumente des Ordens und die Akten der ersten fünf Generalkapitel sprechen für die vollständige Gleichstellung bezüglich des Werkes der Nächstenliebe [...] Aber ihre juridische Gleichstellung wurde diskutiert und sie war umstritten, wie es gewöhnlich geschieht, wenn es darum geht, den charismatischen Sichtweisen ein juridisches Kleid zu geben [...] Die entgegengesetzten Meinungen, die im Orden von Anfang an vorhanden waren, bewegten sich zwischen dem klaren Willen des Gründers für eine komplette Gleichstellung und den vorhandenen juridischen Möglichkeiten, innerhalb derer man sich bewegen und handeln musste, und endeten schließlich mit einem Vorgang der Klerikalisierung zum Schaden der charismatischen Sichtweise des Gründers.”[19]
„Trotzdem manifestierte sich bis zum Tod des Gründers die Klerikalisierung nicht in dem Maß, wie es, wie wir gut wissen, später war. Kamillus war innerlich überzeugt, dass die Zusammensetzung des Ordens aus Patres und Brüdern unverzichtbarer Bestandteil sowohl der Eingebung, die er von Gott erhalten hatte, wie auch des wesentlichen Ordenszwecks war. Da man die gemeinsame Berufung und Sendung erkannte, mussten diese auch in den Strukturen der Ordensleitung sichtbar werden. Den Brüdern sprach man viele Rechte zu, an die man in anderen Orden nicht einmal denken konnte. Auf diese Weise nahmen sie in verantwortlicher Stellung an der Leitung und am Geschick des Ordens teil, sie hatten bezüglich vieler Ämter innerhalb der Gemeinschaft aktives und passives Stimmrecht, so wie es die Priester hatten. Jede Provinz wählte je einen Pater und je einen Bruder für das Generalkapitel; das Definitorium und der Generalrat waren jeweils aus zwei Patres und zwei Brüdern zusammengesetzt; die Provinz- und Hausoberen hatten je einen Pater und einen Bruder als Ratgeber; die Examinatoren der Novizen waren jeweils zwei Patres und zwei Brüder.
Diese Einzigartigkeit des Ordens, die in dieser besonderen Zusammensetzung zum Ausdruck kam, wurde auch durch die päpstlichen Dokumente „Ex omnibus” (1586) und „Illius qui pro gregis” (1591) anerkannt und festgesetzt. Im Schreiben „Superna Dispositione” (1600) hingegen kam es, hervorgerufen durch die Uneinigkeit, zu einem Kompromiss und man gab großen Raum den Vorschriften und Unterscheidungen zwischen dem, was die Patres und was die Brüder tun durften und wieviel die Einen und wieviel die anderen oder alle zusammen machen konnten.”[20]
„Nach dem Tod des Gründers verstand der Orden nicht immer die Besonderheit seiner Zusammensetzung, die ihn von den anderen Kleriker-Orden unterschied, genügend hochzuschätzen. Es handelte sich nämlich nicht um einen Laien-Orden, in dem die Priester allein eine unterstützende Funktion für die Liturgie und die Seelsorge im Spital hatten und auch nicht um einen reinen Kleriker-Orden, in dem der Laien-Komponente nur die Funktion einer Unterstützung in den Angelegenheiten des Haushalts zukam, sondern um einen Orden, in dem die beiden Komponenten in einer Komplementarität der Rollen und Funktionen einen neuartigen, wirksamen, kompletten Dienst als Antwort auf die Bedürfnisse des kranken Menschen verwirklichen konnten.”[21]
Das heute geltende Grundgesetz kehrte zur Sichtweise des Gründers zurück: „Wir alle haben als Mitglieder des Ordens teil an derselben Gnadengabe, sind in derselben Gemeinschaft vereint und übernehmen gemeinsam denselben Sendungsauftrag entsprechend den eigenen Fähigkeiten des Einzelnen und dem vom Orden geforderten Dienst” (Grundgesetz, Art. 14). „Unser Orden, der seinem Wesen nach aus Klerikern und Laien besteht, die von Kamillus Patres und Brüder genannt wurden, hat als Ziel den umfassenden Dienst am Kranken in seiner leib-seelischen Ganzheit. Ihm schenken wir unsere ganze Fürsorge, seinen Bedürfnissen und auch unseren Möglichkeiten und Fähigkeiten entsprechend” (Grundgesetz, Art. 43).
Diese Texte des Grundgesetzes zeigen mit äußerster Klarheit den geringen Grad der „Klerikalität” unseres Ordens und sie tun das in vollkommener Einheit mit der Sichtweise des hl. Kamillus, wie man das zum Beispiel beim zweiten Generalkapitel (Mai 1599) sehen kann. Hier wurde beschlossen, „dass alle, Patres und Brüder, Kleriker und Studenten, Laien sowie Professen und Novizen in den Spitälern leiblichen Krankenpflegedienst verrichten müssen, wie zum Beispiel die Zunge reinigen, Essen verteilen, abwaschen, Betten machen, für die Wärme sorgen, Wachdienste übernehmen, den Kranken beim Waschen helfen, ihnen die Füße wärmen und andere ähnliche Dienste, wie sie heute im Spital Santo Spirito in Rom geleistet werden. Außerdem müssen sie in der Seelsorge mitwirken, etwa die Kranken auffordern, sich gut für den Empfang der Sakramente vorzubereiten, ihnen bei deren Empfang zu helfen, die Sterbenden begleiten, sie stärken und ihre Seelen mit der notwendigen Nächstenliebe empfehlen.”
Nur auf diese Weise kann sich der kamillianische Ordensmann, ob Bruder oder Priester, als würdiger Sohn des hl. Kamillus fühlen, der nochmals in seinem „Testamentsbrief” daran erinnerte: „Außerdem will ich, dass man niemals ausschließlich die Seelsorge ohne den Krankendienst übernimmt, wie dies die zweite Bulle anordnet.”
Das Bedürfnis nach vollkommenen Menschen
Nachdem er angesichts seiner Befürchtungen - zum letzten Male - die Brüder verteidigt hatte, wandte sich Kamillus an alle gegenwärtigen und zukünftigen Mitglieder seines Ordens. Er ermahnt sie „auf den Wegen des Geistes und der wahren religiösen Askese zu wandeln”, um den Willen Gottes zu verwirklichen und zur Vollkommenheit und Heiligkeit zu gelangen. Nur Menschen dieser Art sind im Stande, Gutes zu tun und zur Erbauung der Kirche zu dienen. Dank dieser Mitglieder kann der Orden Fortschritte machen und für die Welt eine wahre Hilfe sein.[22] Der Weg zur Vollkommenheit kann in keiner anderen Weise befolgt werden als im Dienst an den Kranken: „O wie glücklich sind jene Diener der Kranken, wenn sie gut das Talent verwenden, das ihnen der Herr gegeben hat, um in diesem heiligen Weinberg zu arbeiten mit einem frommen und guten Leben, mit brennender Nächstenliebe und mit Erbarmen gegenüber den Gliedern Christi. Armselig sind wir, wenn wir ein solches Talent vergraben. Genug, mein Pater, es ist jetzt nicht die Zeit zu schlafen, suchen wir uns zu heiligen mit einem solch guten Mittel, das wir haben. Das ist das Ziel der Diener der Kranken und wehe dem, der nicht auf diesem Königsweg wandert.”[23]
Der Gründer legt die Betonung auf die Berufung zur Heiligkeit - ein zentraler Aspekt christlichen Lebens und im Besonderen des geweihten Lebens.[24] Das Zweite Vatikanische Konzil betonte sehr deutlich: „Jedem ist also klar, dass alle Christgläubigen jeglichen Standes oder Ranges zur Fülle des christlichen Lebens und zur vollkommenen Liebe berufen sind. Durch diese Heiligkeit wird auch in der irdischen Gesellschaft eine menschlichere Weise zu leben gefördert.”[25]
Das grundlegende Dokument zum Ordensleben, „Vita consecrata”, bestätigte nach 400 Jahren dasselbe Prinzip: „Streben nach Heiligkeit: das ist zusammengefasst das Programm jedes geweihten Lebens [...] Der Anfang dieses Programms besteht darin, dass um Christi willen alles verlassen und er allen Dingen vorgezogen wird, um voll an seinem Ostergeheimnis teilhaben zu können. [...] Von dieser Vorzugsoption, die im persönlichen und gemeinschaftlichen Engagement entfaltet wird, hängen die Fruchtbarkeit des Apostolats, die Selbstlosigkeit in der Liebe für die Armen und die Anziehungskraft der Berufung auf die jungen Generationen selber ab” (Vita consecrata, Nr. 93). Der Weg der vollkommenen Vereinigung mit Gott muss in allen Christen gefördert werden: „Ein erneuertes Engagement der Personen des geweihten Lebens zur Heiligkeit ist heute notwendiger denn je, auch um das Streben jedes Christen nach Vollkommenheit zu fördern und zu unterstützen. [...] Von dieser Heiligkeit geben sie Zeugnis. Die Tatsache, dass wir alle aufgerufen sind, heilig zu werden, muss jene in höherem Maße anspornen, die auf Grund ihrer Lebensentscheidung die Sendung haben, die anderen daran zu erinnern” (Vita consecrata, Nr. 39; vgl. Nr. 103). Das ist es vor allem, was von uns die Laien verlangen, besonders jene, die sich mit unserer Ordensaufgabe verbinden wollen (vgl. Vita consecrata, Nr. 54-56; RR 27-28): „Das geistliche Leben muss also im Programm der Familien des geweihten Lebens an erster Stelle stehen, so dass jedes Institut und jede Kommunität sich als Schule einer echten evangeliumsgemäßen Spiritualität darstellen” (Vita consecrata, Nr. 93).
Einige weitere Zitate, die zeigen, dass die apostolische Tätigkeit erst an zweiter Stelle steht. Sie wird umso unwirksamer, wo sie nicht aus einer inneren Vereinigung mit dem Herrn geschieht: „Ohne ein inneres Leben der Liebe ... kann es keine Sicht des Glaubens geben; folglich verliert das eigene Leben schrittweise an Sinn, das Antlitz der Brüder verblasst und es ist unmöglich, das Antlitz Christi zu entdecken; die Ereignisse der Geschichte bleiben unverständlich ..., die apostolische und karitative Sendung verkommt zu Zerstreuung und Aktivismus” (Neubeginn in Christus, Nr. 25). „Die Kirche braucht Personen des geweihten Lebens, die, noch ehe sie sich dem Dienst an der einen oder anderen edlen Sache widmen, sich von der Gnade Gottes verwandeln lassen und dem Evangelium vollständig gleichförmig werden” (Vita consecrata, Nr. 105).
Für uns Kamillianer ist es der Dienst an den Kranken, „der eine eigene Spiritualität hervorbringt, das heißt einen konkreten Plan der Beziehung zu Gott und zur Umgebung, der von besonderen geistlichen Akzenten und Entscheidungen zum Handeln gekennzeichnet ist” (Vita consecrata , Nr. 93) und Jesus als den barmherzigen Samariter und den anwesenden Christus in den Kranken herausstellt. Oft aber lebt man eine Art von Spaltung zwischen Kontemplation und Aktion, zwischen Gebet und Arbeit. Es ist jedoch notwendig, zu einer Synthese zu kommen, um kontemplativ in der Aktion zu werden, wie dies im höchsten Grad beim hl. Kamillus der Fall war. „Bei den Ordensleuten des aktiven Lebens handelt es sich darum, die Verbindung von Innerlichkeit und Tätigkeit zu stärken. Ist es doch ihre erste Pflicht, mit Christus verbunden zu sein. Eine ständige Gefahr für die apostolisch Tätigen besteht darin, sich derartig von der eigenen Tätigkeit für den Herrn einnehmen zu lassen, dass sie darüber den Herrn jeder Tätigkeit vergessen” (Johannes Paul II., Botschaft an die Plenaria, SCRIS 1980, Nr. 4).
Vom hl. Kamillus kann man sagen, dass er kontemplativ in der Aktion und aktiv in der Kontemplation war. P. Sannazzaro schreibt in seiner Studie: „In ihm gab es keinen Widerspruch, kein Auseinanderklaffen zwischen Gebet und Aktion. In der Ausübung des Dienstes hatte er das Bewusstsein und die Gewissheit, Christus im Kranken zu dienen. Es wurde ihm daher selbstverständlich, den Kranken mit größter Aufmerksamkeit und liebevoll zu pflegen und ihn als seinen Herrn zu verehren.”[26]
Hier genügt es, sich nur an folgende Begebenheit zu erinnern: „Ich erinnere mich an Folgendes. Pater Kamillus ging sehr oft im Spital herum, um an den Kranken die Nächstenliebe auszuüben. Sein Gesicht war von Liebe und Eifer derart beseelt, dass er nicht bei sich war und sich hüpfend und taumelnd bewegte und den Mund des armen Kranken nicht fand, dem er die Speise geben wollte. Als ich mich ihm näherte und ihn darum bat, dass er mir den Teller gebe, gab er mir keine Antwort, weil er sich in Verzückung befand, und dies war bereits eine längere Zeit der Fall. Dann kehrte er zurück und seufzte und deshalb nahm ich an, dass er sich aufgrund seiner großen Nächstenliebe in Ekstase befunden hatte. Das war sehr oft der Fall und es entspricht der Wahrheit.”
Falls die innige Vereinigung mit Gott vorhanden ist, verbessert sie nicht die Lebensumstände des Geweihten, der Kommunität oder des Ordens, aber sie ist eine wesentliche Voraussetzung dafür, dass man von einer Person als von einem „Geweihten” oder von einer Gruppe von Personen (Ordenspersonen oder Laien) als von „Geweihten” sprechen kann und nicht nur von einer einfachen „Ansammlung” von Menschen guten Willens. „Denn noch ehe sich die Sendung durch äußere Werke kennzeichnet, entfaltet sie sich dadurch, dass sie durch das persönliche Zeugnis für die Welt Christus selbst gegenwärtig macht. Das ist die Herausforderung, das ist die erstrangige Aufgabe des geweihten Lebens! Je mehr man Christus gleichförmig wird, umso gegenwärtiger und wirksamer macht man ihn in der Welt zum Heil der Menschen” (Vita consecrata, Nr. 72).
Die „handlungsrelevanten” und menschlichen Aspekte sind zwar sehr wichtig im Ordensleben, aber sie sind „zweitrangig” in dem Sinn, dass sie an zweiter Stelle stehen müssen in der Tagesordnung der Einzelnen und der Gemeinschaft.
Das wichtigste Ziel unseres kamillianischen Lebens darf nicht der Erfolg unserer apostolischen Tätigkeit sein, sondern die Heiligkeit der Mitglieder. Man kann die modernsten Anstalten haben, man kann noch so viele Kranke behandeln und eine Menge bewundernswerter Initiativen verwirklichen. Wenn man aber das erste Ziel unserer Ordensweihe aus dem Blick verliert, als Einzelner oder als Orden, sind wir Gescheiterte: Wir sind dann tüchtig, was die sekundären Ziele angeht, aber unfähig, das Hauptziel zu erreichen, dessentwegen wir uns geweiht haben.
Es ist eine subtile und ständige Versuchung, als „Spezialisten des Gesundheitswesens” zu leben und an die zweite Stelle zu stellen, dass wir ganz dem Herrn geweiht sind, beziehungsweise dass wir „Spezialisten für die Heiligkeit” sind. Auf diese Weise muss unsere kamillianische Spiritualität und unser spezifisches Charisma gelebt werden. Und insofern diese gelebt werden, sollen sie auch an andere Menschen vermittelt werden, wie dies das Kapiteldokument von 2001 haben will: „Auch die Unterweisung in der kamillianischen Spiritualität soll mehr gefördert werden - indem sie ein Teil des Programms in unseren Ausbildungszentren wird, in der Weise, dass das Erbe, das uns der hl. Kamillus hinterlassen hat, außer durch das einfache Beispiel auch in systematischer und durchdachter Weise weitergegeben wird” (Nr. 44).
Was kann dann geschehen, wenn das Streben nach Heiligkeit verloren geht? Der Gründer drückt das mit folgenden Worten aus: „Dann werden es die Sinnlichen, Geistlosen und die der Askese Abgeneigten, die unseren Orden ruinieren.” Ich glaube, dass dies keines Kommentars bedarf. Ich füge nur einen Satz hinzu, der etwas übertrieben scheint, aber das unterstreicht, was in Wirklichkeit geschieht. Wenn der Teufel unserem Orden das größte Übel antun wollte, dann müsste er nur denen helfen, die nicht mit Gott vereint sind, damit sie große Initiativen, oder noch schlechter, fast Wunder verrichten könnten. Wenn er darin Erfolg hätte, wäre dies ein immenser Schaden für den Orden![27]
Bei genauerem Hinsehen lässt sich hier das Thema Ausbildung entdecken. Es ist notwendig, dass sich ein jeder von uns einer Aus- und Weiterbildung hinterzieht, die ihn auch weiterbringt.
Diese Ermahnung bezieht sich auf zwei verschiedene Aspekte. Zunächst, dass der Diener der Kranken nicht ausschließlich der Seele des Kranken oder dem Leib einen Dienst erweist, sondern sich um den Menschen als Ganzen kümmert. Der zweite Grund ist, dass es in den kommenden Zeiten geschehen könnte, dass jemand gegenüber dem Beistand der Kranken andere Formen des Apostolates bevorzugen könnte.
Der hl. Kamillus handelte stets in der Überzeugung, dass man keine saubere Trennung machen kann zwischen Seele und Leib, wenn man sich in den Dienst eines kranken Menschen stellt. Seine Ordensleute mussten sich um den Menschen in der Ganzheit ihrer Bedürfnisse, bei Tag und bei Nacht, kümmern, und zwar in den Spitälern und in den Privathäusern, sowohl in gewöhnlichen Zeiten als auch in Zeiten von Epidemien und Pest. Da nämlich die ganze Person von der Krankheit und dem Leiden betroffen ist, sind auch die Bedürfnisse physischer, psychischer und spiritueller Art. Die Krankheit zieht die gesamte Person (Körper, Seele und Geist) in Mitleidenschaft und auch die Umgebung der kranken Person (Familienangehörige und Pflegepersonal).
Wir sind deshalb gerufen, nicht eine physische Krankheit zu heilen, sondern uns um eine Person zu kümmern, nämlich um ein bestimmtes Individuum, um den ganzen Menschen in der Gesamtheit seiner Bedürfnisse. Es handelt sich sicherlich um Prinzipien, die wir gut kennen und vielleicht schon in die Praxis umsetzen, aber wir müssen sie ständig in unsere Erinnerung und in unser Herz zurückrufen und uns mit der Absicht auseinandersetzen, die unser Gründer hatte.
Die vielen kamillianischen Märtyrer der Nächstenliebe geben ein deutliches Zeugnis von der Härte und der Gefährlichkeit eines Dienstes, der mit bewundernswerter Selbstverleugnung ausgeübt wurde.[28] Sehr oft war ein heroisches Verhalten gefordert, auszuharren und sein Leben auch bei Todesgefahr aufzuopfern.[29] Dies erfuhren auch die Ordensleute, die in das Allgemeine Spital Ca’Granda nach Mailand geschickt worden waren. Hier endlich sah der hl. Kamillus seinen Traum verwirklicht: die komplette Übernahme des Dienstes in einem Spital und damit die „Befreiung” der Kranken „aus der Hand der Söldner”. Das war sein ursprüngliches Vorhaben, das er niemals aufgegeben hatte, das ihm aber großen Widerstand von Seiten seiner Ordensleute und vom Heiligen Stuhl brachte.
Für Kamillus müssen alle Energien, sowohl die inneren als auch die äußeren, reichlich eingesetzt werden, um das vierte Gelübde auszuüben, auch unter der Strafe einer Todsünde. Daher waren die Kamillianer frei von vielen Dingen, wie sie in anderen Orden üblich waren (Predigten, Chorgebet, Beichthören), und hatte nicht die Bußübungen zu verrichten, wie deren Mitglieder (Nachtwachen, Fasten, Geißelungen und Prozessionen).
Kamillus hatte auch die Gefahr vor Augen, dass vor allem die Priester und die weniger Belastbaren das Krankenbett verließen, um sich anderen Formen der Seelsorge zu widmen: „Es ist nicht der Zweck unseres heiligen Institutes, in der Kirche Beichte zu hören und die Gotteshäuser mit Beichtstühlen anzufüllen: Dies ist nicht die Hauptsache und wehe dem, der sich darin ausbreitet.”[30] Milde ausdrückt kann man sagen, dass es dann doch bald im Orden zu einer Wende hin zum Klerikalismus kam.
Ich habe schon die heutige Situation kurz angedeutet, in der sehr wenige Kamillianer sich der Krankenpflege widmen und sehr viele hingegen in der Seelsorge tätig sind. Es wäre noch zu ergänzen, dass sich ein kleiner Teil um die Verwaltung der Anstalten oder um den Unterricht kümmert und andere wiederum in Pfarreien oder Rektoraten tätig sind. Das sind Tatsachen, die man nicht einfach kritisieren soll, über die es sich aber nachzudenken lohnen würde.
Kamillus ist schwer krank und fühlt sich im Krankenzimmer des Konvents der Maddalena dem Hinübergang sehr nahe. Er bittet seine Mitbrüder, aus Liebe zu Gott nicht nur um die von der Ordensregel vorgesehen Gebete, sondern um etwas mehr. Der angeführte Grund besteht darin, dass er es mehr nötig hat als die anderen. Er bittet nicht darum, weil er Generaloberer und Gründer war, denn während seines ganzen Lebens hatte er niemals zugelassen, dass man ihn deswegen besser behandelt hätte.[31] Er hatte die tiefe Überzeugung, dass er ein großer Sünder sei, und allein aus diesem Grunde wagte er um einige Gebete mehr für sein Seelenheil zu bitten. Kamillus empfahl sich auf dem Sterbebett ganz der Barmherzigkeit Gottes. Wir wissen, dass er darum bat, dass für ihn ein Bild des Gekreuzigten gemalt werde, von dem herab reichlich Blut floss und das ihn an das Heil erinnerte, das der Erlöser durch das Vergießen seines Blutes erwirkt hatte. Auf dieses Kruzifix richtete er ununterbrochen seine Augen und auf den Gekreuzigten vertraute er im Blick auf sein ewiges Heil.
Er, der so vielen Sterbenden beigestanden war, wusste, dass die Agonie ein wirklicher Kampf ist mit der dunklen und schwachen Seite seiner selbst. Der Teufel spielt seine letzten Karten aus, um den Sterbenden die Hoffnung auf den Herrn zu nehmen. Von dem Zeitpunkt seiner Bekehrung an bis zu diesem Augenblick war es ihm gelungen, niemals willentlich eine lässliche Sünde zu begehen. Er wollte mit aller Kraft bis zu seinem Ende mit dem Herrn verbunden bleiben. Mit diesem Ziel verrichtete er öffentlich vor seinen Mitbrüdern die so genannten „Beteuerungen”, beziehungsweise die Glaubensbekenntnisse. Lenzo berichtet: „Kamillus wurde so begraben, wie er darum gebeten hatte: Mit diesen Glaubensbeteuerungen um den Hals gebunden. Er bekannte auf diese Weise - mündlich zu Lebenszeiten und schriftlich als Toter - seinen festesten Glauben an Christus dem Herrn und Erlöser.” Kamillus bat die bei der Lektüre seines „Geistlichen Testamentes” anwesenden Mitbrüder als Zeugen seines Willens, das Dokument zu unterschreiben, das mit dem 12. Juli 1614 datiert ist. Dieses „Geistliche Testament” ist verschieden von den „Beteuerungen”, die man damals für gewöhnlich den Sterbenden ablegen ließ.
In diesem Testament findet die Spiritualität des Kamillus ihren grundsätzlichen Ausdruck. Eine genaue Analyse gehört hier nicht zu meiner Aufgabe, aber ich gebe hier sehr gern - zum Abschluss dieser Überlegungen - einige Textstellen wieder. Sie verhelfen uns dazu, Kamillus besser zu kennen, ihn mehr zu lieben und ihn nachahmen zu wollen.
Er, der Gründer unseres Ordens beginnt das Schriftstück mit folgenden Worten: „Ich, Kamillus von Lellis, unwürdiger Priester meines Ordens der Diener der Kranken.” Dann fährt er fort: „Zunächst überlasse ich diesen meinen Leib aus Erde eben dieser Erde ...
Außerdem überlasse ich dem Teufel, dem ungerechten Versucher, alle Sünden und alle Verfehlungen, die ich gegen Gott begangen habe, [...] und würde viel lieber tot sein wollen, als ihn durch die kleinste Sünde verletzt zu haben, so wie ich dies ungerechterweise getan habe; und diese Reue will ich, dass sie vor allem um der Liebe Gottes sei und nicht wegen irgend eines eigenen Interesses oder aus Furcht, [...] und wenn der Teufel mir Skrupel eingibt, dass ich nicht gut gebeichtet hätte oder nicht verdiente, dass mir die Sünden vergeben werden, oder dass ich kein Erbarmen verdiene, so hoffe ich in jedem Fall fest auf Gott, der mir sicher vergeben wird, [...] und erwarte, dass mich Gott auch ohne Sakramente retten kann, [...] in der Hoffnung, dass ich sicher errettet werde, nicht durch meinen Verdienst, der ich den Tod verdient habe, sondern durch das Verdienst des Blutes Christi [...] Ebenso überlasse ich der Welt alle Eitelkeiten, alle hinfälligen Dinge, alle weltlichen Vergnügungen, alle leeren Hoffnungen, alle Besitze, alle Freunde, alle Verwandten und alle Kuriositäten [...] Ich möchte dieses Erdenleben eintauschen mit der Gewissheit des Paradieses, diese vorläufigen mit den ewigen Dingen, die weltlichen Freuden mit der Herrlichkeit des Himmels, die vergeblichen Hoffnungen mit der Gewissheit des ewigen Heiles [...] All meine Habe möchte ich mit den ewigen Gütern eintauschen, all meine Freunde mit der Gesellschaft der Heiligen, alle Verwandten mit der Liebenswürdigkeit der Engel und schließlich alle weltlichen Sehenswürdigkeiten mit der wahrhaften Schau des Angesichtes Gottes und ich hoffe, dass ich seiner göttlichen Barmherzigkeit recht sein werde [...]
Ferner überlasse ich meinem Leib in der kurzen Zeit, die ich noch zu leben habe, alle Schmerzen, Krankheiten und Gebrechen, und was immer Gott ihm schicken wird [...], und ich erkläre, es zu ertragen und Geduld zu haben in jeder Widerwärtigkeit; aus Liebe zu demjenigen, der auf dem Kreuz für mich sterben wollte, will ich auch die Appetit- und Schlaflosigkeit und die schlechten Worte ertragen. Ich will auch dem, der mich leitet, aus Liebe zu Gott Gehorsam leisten. Mit Geduld will ich jede bittere Medizin, jedes schmerzhafte Heilmittel und jede Plage bis zum Todeskampf selbst ertragen, aus Liebe zu Jesus, der selbst eine weit größere Agonie erlitten hat für mich [...] Und ich bereue alle meine Sünden, die ich eventuell begangen habe, indem ich mich selbst und meinen Leib in ungeordneter Weise geliebt habe [...]
Außerdem übergebe und schenke ich meine Seele und jede einzelne ihrer Fähigkeiten meinem geliebten Jesus und seiner heiligsten Mutter, dem heiligen Erzengel Michael und meinem Schutzengel, und zwar in der folgenden Weise: Dem Schutzengel übergebe ich mein Erinnerungsvermögen [...] Euch, meinem heiligen Engel, danke ich noch für so viele erwiesene Gunsterweise und bitte Euch, dass ihr mich jetzt mehr als je zuvor beschützt, indem Ihr mir Mut, Hilfe und Kraft gebt, dass mein Lebensende glücklich verlaufe [...]
Ebenso überlasse ich meinen ganzen Verstand dem heiligen Erzengel Michael und erkläre, dass ich in Glaubensangelegenheiten mit dem Teufel weder die Absicht habe zu diskutieren noch zu streiten, sondern ich will fest all das glauben, was die heilige katholische, apostolische und römische Mutter Kirche glaubt [...]
Letztendlich übergebe ich Jesus Christus dem Gekreuzigten meine ganze Person mit Seele und Leib und vertraue darauf, dass er aus seiner reinen Güte und Barmherzigkeit heraus mich empfangen wird (obwohl ich unwürdig bin, von einer solch göttlichen Majestät empfangen zu werden), so wie einst der gute Vater seinen verlorenen Sohn empfing, und auch mir vergeben wird, wie er der Magdalena vergab, und mir wohl gesonnen sein wird, wie er es für den rechten Schächer war, als dieser am Ende seines Lebens am Kreuze hing. Ebenso wird er in diesem letzten Gang meine Seele empfangen.”
Mit diesem Schriftstück in den Händen übergab er seine Seele dem Herrn. Während Pater Mancini die Anrufung betete, „gütig und festlich zeige der Herr dir sein Angesicht”, verschied Kamillus mit lächelndem Gesicht. Es war Montag, der 14. Juli 1614, um 21.30 Uhr - der Tag, seit langem erwartet, an dem unser Gründer die Stimme des Herrn vernahm, die ihn in die freudige und ewige Gemeinschaft der Allerheiligsten Dreifaltigkeit aufnahm, mit den so oft gesprochenen und meditierten Worten: „Komm, Gesegneter meines Vaters, weil ich krank war und du mich besucht hast!”
Vom Himmel aus hört er nicht auf, für seine Söhne und seinen Orden einzutreten, damit wir die von Gott erwarteten Früchte bringen. Und von seinem Herzen, entflammt von der göttlichen und fürsorglichen Liebe, kommen immer noch - wie auf seinem Sterbebett - nicht nur eine, sondern „tausend Segnungen nicht allein für die gegenwärtigen, sondern auch für die zukünftigen Arbeiter in diesem heiligen Orden bis zum Ende der Welt”.
Rom-Ariccia, 24. Mai 2011.
Der gesamte Testamentsbrief ist nachzulesen unter: www.kamillianer.at/kvlellis/kt_0.htm.


© Kamillianer 2011 - 08.07.2011 [Stand: 08.07.2011]
zurück
![]() zu den Tagungsberichten
zu den Tagungsberichten